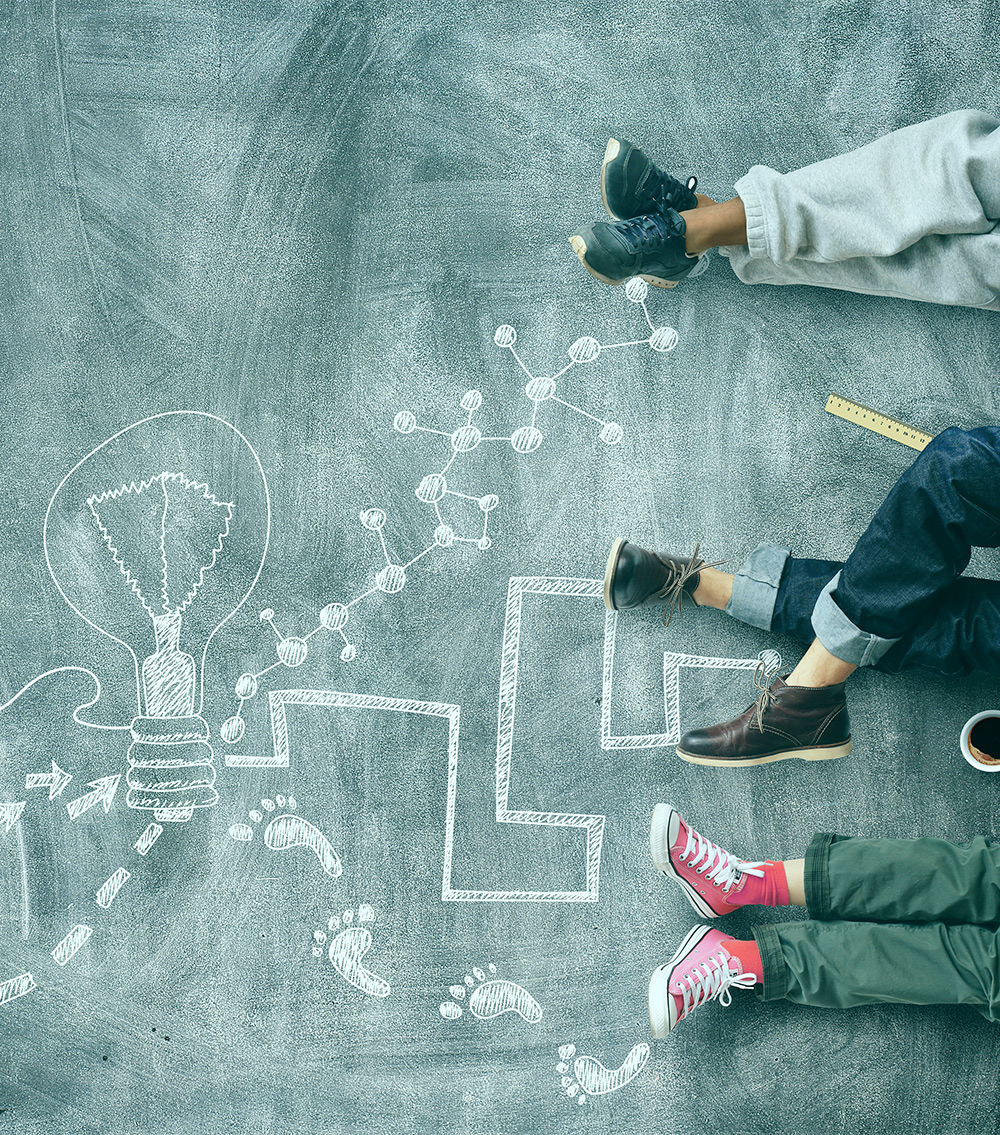
Informelle Bildung
Das vorliegende Issue baut auf dem Positionspapier «Die offene Kinder- und Jugendarbeit als Akteurin einer Bildungslandschaft» des Verbands voja aus dem Jahre 2015 auf. «Bildungslandschaften» setzen sich aus Schulen und ausserschulischen Bildungsakteur*innen zusammen, welche miteinander vernetzt sind. In diesem Issue soll dargestellt werden, wie sich die Ausgangslage für die Akteur*innen der Bildungslandschaften verändert hat und welche Rolle und Herausforderungen der OKJA darin zukommen.
Informelle Bildung
Unter «Bildungslandschaft» wird ein bildungspolitisches Konzept verstanden, das die Vernetzung von Schulen und ausserschulischen Bildungsakteur*innen vorsieht. Diese Kooperation soll die Bildungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen erweitern und die Chancengerechtigkeit verbessern. Die Bildungslandschaft umfasst somit sowohl formelle – dafür sind die Schulen hauptsächlich verantwortlich – als auch informelle Bildungsangebote. Unter dem Begriff «Informelle Bildung» (Verband voja 2015: 4) werden alle ungeplanten und nicht beabsichtigten Bildungsprozesse verstanden. Diese Form des Lernens lässt sich nur bedingt steuern. Aus diesem Grund ist es ein Ziel der OKJA, Gelegenheitsstrukturen für informelle Bildungsprozesse zu schaffen und zu unterstützen. Die Angebote für informelle Lernprozesse in der Kinder- und Jugendarbeit zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Anspruchsgruppen Orte und Gelegenheiten bieten, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Informelle Bildung ist im Wesentlichen dadurch charakterisiert, dass die Kinder und Jugendlichen selbst ihre (Bildungs-)Ziele formulieren und dies freiwillig tun. Diese verschiedenen Lernmöglichkeiten ergänzen sich gegenseitig und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Im Hinblick auf ein umfassendes Bildungsverständnis gilt es somit die komplementären Funktionen der beteiligten Akteur*innen optimal zu nutzen.
Veränderte Ausgangslage für die Akteur*innen der Bildungslandschaft
In den letzten Jahren hat sich die Bildungslandschaft verändert, insbesondere der Lernort Schule ist davon betroffen. Die formelle Bildung findet in einem Lernumfeld statt, das die verschiedenen Ressourcen der Schüler*innen besser berücksichtigen und die überfachlichen Kompetenzen fördern soll (Bildungs- und Kulturdirektion Kanton Bern). Zudem wurden die Anzahl der Schulstunden erhöht und der Ausbau der Tagesschulen in den Gemeinden forciert. Eine der Konsequenzen daraus ist, dass die freien, ausserschulischen Zeitfenster für die Kinder und Jugendlichen kleiner geworden sind. Davon sind auch die klassischen Angebote der OKJA betroffen, die entsprechend weniger genutzt werden können. Damit ist die skizzierte, notwendige Komplementarität der schulischen und der ausserschulischen Bildungsangebote in Frage gestellt und es braucht ein kooperatives Vorgehen, um dieser Herausforderung zu begegnen. Unbestritten ist, dass die Schulen eine koordinierte und systematische Unterstützung benötigen, um den Anstieg der Integrationsaufgaben und Erwartungen hinsichtlich der Vermittlung von nicht wissensbezogenen Kompetenzen nachzukommen. Umfassende Bildung, welche die Kinder und Jugendlichen zur Selbstständigkeit befähigt, wird somit zu einer gesellschaftspolitischen Aufgabe, die nur durch eine Koordination zwischen den beteiligten Akteur*innen erfolgen kann (Éducation21).
Rolle der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Bildungslandschaft
Auch wenn sich die Schule mittlerweile stärker an den Ressourcen und den Kompetenzen der Schüler*innen orientiert, ist die Bereitstellung von Angeboten, die auf Freiwilligkeit basieren, ein zentraler Punkt. Es braucht für die Kinder und Jugendlichen Erholungsmöglichkeiten, es braucht einen Ort, an dem sie unter sich (und dennoch sich selbst) sein können. Es braucht Angebote für diejenigen, welche überfordert sind bezüglich des Anspruchs des selbstständigen Lernens, die benötigte Hilfe in der Schule aber nicht einfordern und auch nicht die notwendige familiäre Unterstützung erhalten. Es braucht Angebote, in deren Rahmen das intrinsisch motivierte Lernen ermöglicht wird. In diesen Bereichen kommt der OKJA eine grosse Bedeutung zu. Dabei ist zu prüfen, wann die OKJA im schulischen Kontext (in enger Absprache mit der Schule oder im Auftrag der Schule) und wann sie im ausserschulischen Umfeld agiert. Damit dies gelingt, braucht es eine Kooperation auf gleicher Augenhöhe und die Überzeugung, dass komplementäre Bildungsangebote notwendig sind, um den Ansprüchen der Chancengerechtigkeit und der Befähigung so gut wie möglich gerecht zu werden.
Betroffene Politikbereiche
Bildungspolitik
- Die Kooperation zwischen schulischen und ausserschulischen Akteur*innen ermöglicht Kindern und Jugendlichen vermehrt gleichberechtigte Chancen auf eine qualitativ gute und umfassende Bildung.
- Die OKJA schliesst Lücken, schafft Brücken und engagiert sich subsidiär und ergänzend zu den bestehenden Angeboten.
Sozialpolitik
- Informelle Bildungsangebote als Möglichkeit, Kinder und Jugendliche, die sozial benachteiligt sind, in Bezug auf die schulischen und gesellschaftlichen Anforderungen zu befähigen.
Gesundheitspolitik
- Die OKJA zielt im Bildungsbereich auf Selbstbestimmung und auf die persönlichen Kompetenzen. Damit erfüllt sie eine wichtige gesundheitsfördernde Aufgabe.
Potential und Herausforderungen
Potential
- Bildungsangebote, die in einem freiwilligen Rahmen stattfinden und die Partizipation sowie das intrinsisch motivierte Lernen fördern und unterstützen.
- Informelle Bildungsangebote, die für die Bildung und Erziehung zentral sind.
- Flexible Bildungsangebote, die gender- und zielgruppengerecht konzipiert werden können.
- Expertise im Bereich der Förderung von Handlungskompetenzen, da die OKJA diese Kompetenzen immer schon mitgedacht hat.
- Erkennen von Lücken in der Bildungslandschaft und Entwickeln von Angeboten, die auf diese Lücken reagieren.
- Zusammenarbeit mit der Schule in bestimmten Kontexten; in anderen Zusammenhängen wird dann bewusst die Zusammenarbeit nicht institutionalisiert.
- Beziehungsarbeit nutzen, um auf die Bildungsbiographie der Kinder und Jugendlichen bei Brüchen, Fragen, Schwierigkeiten einzugehen.
- Die formellen Bildungsangebote geniessen im Gegensatz zu den nonformalen Bildungsangeboten bei allen Bevölkerungsgruppen eine hohe Akzeptanz. Durch die Koppelung innerhalb von Bildungslandschaften, wird mehr Kindern den Zugang zu informeller Bildung ermöglicht.
Herausforderungen und Probleme
- Wenn die ausserschulischen und schulischen Angebote koordiniert werden, braucht es eine Kooperation zwischen den Akteur*innen auf gleicher Augenhöhe. Im Praxisalltag kann dies eine Herausforderung sein.
- Die OKJA muss die Kooperation mit der Schule gezielt da einsetzen, wo es Sinn macht. Ansonsten ist es für die Kinder und Jugendlichen wichtig, dass sie einen Ort und Fachpersonen finden, die nichts mit Schulen bzw. Tagesschulen zu tun haben.
Werte / Haltungen / Forderungen
Umfassendes Bildungsverständnis
Bildung geschieht überall, in der Schule wie auch in der Freizeit oder in der Familie. Alle Beteiligten leisten einen wichtigen Beitrag zu einer ganzheitlichen Bildung. Dabei hat die OKJA die Möglichkeit, einen Spiel- / Experimentierraum in Ergänzung zum extrinsischen Leistungsparadigma anzubieten.
Gleichberechtigte Vernetzung der Beteiligten
Ausserschulische und schulische Angebote müssen koordiniert werden. Es braucht sowohl ein Zusammengehen wie auch ein Sich-voneinander-Abgrenzen der Akteur*innen. Durch das Sichtbarmachen werden bestehende Lücken erkannt und können geschlossen werden.
Relevanz gem. Ziele FKJV* (ehem. ASIV)
Integration
Die OKJA als Akteurin der Bildungslandschaft, leistet einen wichtigen Integrationsauftrag. Dies betrifft zum einen die soziale Integration, indem sie auf verschiedene Formen der Benachteiligung
reagiert und die Kinder und Jugendlichen in ihrem Selbstwertgefühlt stärkt. Zum anderen betrifft dies aber auch die berufliche Integration. Die OKJA schliesst hier Lücken und übernimmt eine Brückenfunktion. Sie öffnet zudem Türen zu Informationen und bietet niederschwellige Beratung und Orientierungshilfe an.
Sozialisation
Durch die Schaffung von informellen Bildungsangeboten werden die Kinder und Jugendlichen zur Entwicklung weiterer Kompetenzen befähigt, die für die gesellschaftliche Teilhabe wichtig sind.
*Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration, Kanton Bern (ASIV)
Leistungen OKJA
Lebensweltorientierung / Ressourcenorientierung
Die OKJA orientiert sich an den Lebenssituationen der Zielgruppe. Sie erkennt Anliegen, Ressourcen und Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt. Diese ist geprägt von Elternhaus, Schule, Wohnquartier, Peergroup, Lehrbetrieb / Arbeitsort, Vereinen, aber auch von vorhandenen oder fehlenden Freiräumen und Freizeitmöglichkeiten. Bei der Bearbeitung der Themen wird deshalb die subjektive Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen mit einbezogen. Ressourcen werden gezielt zur Realisierung von Projekten und zur Bewältigung von Schwierigkeiten genutzt. Damit dies gelingen kann, werden lokale Kontakte und Netzwerke einbezogen, gepflegt und bei Bedarf aufgebaut.
Freiwilligkeit
Kinder und Jugendliche nutzen Angebote der OKJA zum grössten Teil in ihrer Freizeit. Sie entscheiden grundsätzlich autonom, ob, in welchem Masse und wie lange sie die Angebote der OKJA nutzen und sich bei den bereitgestellten Aktivitäten engagieren wollen. Durch die Freiwilligkeit beteiligen sich Kinder und Jugendliche intensiv dort, wo ihre Interessen liegen, und entwickeln so ein hohes, weil selbstbestimmtes Engagement. Andererseits kann es auch vorkommen, dass Projekte und Aktivitäten nicht stattfinden, wenn die betreffenden Kinder und Jugendlichen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können oder wollen. Kinder und Jugendliche deklarieren grundsätzlich ihren Bedarf selber. Die OKJA ist bestrebt, Kinder und Jugendliche so weit wie möglich an der Gestaltung der Angebote zu beteiligen.
Beziehung
Eine gelungene Beziehungsarbeit zwischen Fachpersonen der OKJA und der Zielgruppe ist die Grundlage für die fachliche und emotionale Begleitung der Kinder und Jugendlichen sowie für alle weiteren Aktivitäten der OKJA. Fachpersonen der OKJA bieten Kindern und Jugendlichen einen verlässlichen, vertrauensvollen Beziehungsrahmen und nehmen eine Vorbildfunktion ein. Dadurch erhalten die Kinder und Jugendlichen Orientierung, entwickeln soziale Kompetenzen und erleben Meinungs- und Handlungsvielfalt.
Informelles Lernen
Das Lernen in der Freizeit ist neben dem Lernen in Schulen und innerhalb der Berufsbildung eine weitere wichtige Säule für umfassende Bildung. Lernen in der OKJA erfolgt freiwillig und interessensgesteuert – sei dies über die Beteiligung an Aushandlungsprozessen, über das Erproben von sozialen Interaktionen, über den Erwerb von Selbst- und Sozialkompetenzen, wie z.B. bei der Übernahme von Verantwortung beim Betrieb eines Kinder- und Jugendtreffs oder über die Mitwirkung bei Angeboten und Projekten bei den für die Zielgruppe relevanten Themen. Nonformale und informelle Bildungsmöglichkeiten leisten einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit, denn sie sprechen auch Kinder und Jugendliche an, die im formalen Bildungssystem auf Schwierigkeiten stossen. Weil nicht ausschliesslich das leistungsbezogene Lernen im Zentrum steht, sind non-formale und informelle Bildungssettings besonders geeignet, um Kinder und Jugendliche abzuholen, die in der formalen Bildung benachteiligt sind.
Vernetzung
Die OKJA ist Teil der Bildungslandschaft und pflegt die Vernetzung zu relevanten Fachstellen. Die Vernetzung ist Basis für alle weiteren Leistungen.
Konkreter Nutzen
für Kinder / Jugendliche
- Erweiterung des Bezugssystems.
- Eigenen Wert und Identität erkennen. Grundvertrauen wird gestärkt.
- Ungezwungen über Schwächen und Stärken in der Schule und in der Freizeit sprechen.
- Erfahren, dass Lernen nichts mit Bewertung und Leistung zu tun haben muss.
- Spüren, dass Bildung nicht nur in der Schule stattfindet.
- Wissen / Information über Angebote erhalten.
für Gemeinden / die Gesellschaft
- Früherkennung.
- Erhöhung der Chancengleichheit.
- Gezielter Einsatz der fachlichen, finanziellen, räumlichen Ressourcen.
- Umfassende, vielfältige Angebote für Familien.
Good Practice
Bildungslandschaft futurina, Bern-West
Futurina ist ein Projekt der Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit VBG und der Stadt Bern und fördert Kinder ab vier Jahren und Jugendliche in den Quartieren Untermatt, Stöckacker und Schwabgut. Futurina stärkt die Zusammenarbeit zwischen den Familien, den Schulen und verschiedenen Organisationen im Quartier. Angebote für Kinder und deren Familien werden durch futurina besser zugänglich gemacht. Dies erhöht die Bildungschancen der Kinder.
vbg Bern
Stephanie Schär
Treffpunkt Untermatt
Bümplizstrasse 21
3018 Bern
Email: Stephanie.schaer@vbgbern.ch
Tel. 031 992 49 82
www.vbgbern.ch
Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen der Stadt Bern
Das Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen ist ein lebendiges Informations- und Kommunikationssystem zwischen Schulen, Verwaltung und Quartier, wobei die Akteur*innen gut aufeinander abgestimmt sind. Ziel ist, mit konkreten Massnahmen ein gutes Schulklima zu fördern.
Gesundheitsdienst Stadt Bern
Monbijoustrasse 11
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 321 68 27
Email: gsd@bern.ch
www.bern.ch
Kindermitwirkung im Rahmen des Gesamtprojekts «grossflächige Begegnungszone Obstberg», Stadt Bern
Anlässlich der geplanten Aufwertung von Spiel- und Begegnungsräumen im Wohnumfeld wurde in enger Kooperation mit der Quartierschule ein Partizipationsprojekt durchgeführt. Dabei wurde das Spiel- und Freizeitverhalten von Schulkindern bis zur 9. Klasse erhoben. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die weitere Planung der Begegnungszone.
DOK Bern
Fachstelle DOK Impuls
Haslerstrasse 21
3008 Bern
Email: dok.impuls@spieleninbern.ch
Tel. 031 332 16 60
www.spieleninbern.ch
Bildungslandschaften21, Stadt Bern
Von 2013 bis 2019 unterstützte die Jacobs Foundation schweizweit 22 Quartiere, Gemeinden und Regionen beim Aufbau einer lokalen Bildungslandschaft. In dieser Zeit haben alle Beteiligten viel ausprobiert und viel gelernt. Die Anlaufstelle Bildungslandschaften21 möchte die dabei gewonnenen Erkenntnisse weitergeben und damit Akteur*innen im Aufbau eigener Bildungslandschaften unterstützen.
Bildungslandschaften21
éducation21
Monbijoustrasse 31
3011 Bern
Tel.: 031 321 00 21
info@bildungslandschaften21.ch
www.bildungslandschaften21.ch
Toolbox "Inspiration und Hilfestellungen für den Aufbau einer Bildungslandschaft": Im voja-Downloadcenter.
Bildungslandschaft Lausanne (Grand-Vennes)
Die «Bildungslandschaft Lausanne» will das soziale und wirtschaftliche Umfeld der Kinder und Jugendlichen im Quartier Grand-Vennes mobilisieren – mit dem Ziel, den Schüler*innen den Einstieg in einen Beruf zu erleichtern. Die Bildungslandschaft engagiert sich für die schulische und soziale Integration und ermöglicht den Beteiligten, sich kennenzulernen und sich auszutauschen. Die Jugendlichen sollen mit den Beteiligten aus der Wirtschaft des Quartiers in Kontakt kommen. Sie sollen dank diesem Netzwerk die Möglichkeit erhalten, Zukunftsprojekte zu entwerfen, ihre beruflichen Interessen zu definieren, sich fehlende Kompetenzen anzueignen und den Arbeitsmarkt kennenzulernen. Ausserdem sollen sie sich dessen bewusst werden, dass auch sie einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten können.
Ville de Lausanne
Secrétariat général de la Direction Enfance, jeunesse et quartiers
Place Chauderon 9, Case postale 5032
1002 Lausanne
Tel. 021 315 67 07
www.lausanne.ch